www.trafoturm.eu |
|||||||||
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|||||
| Alle Stärke liegt innen, nicht außen. (Jean Paul) | |||||||||
|
Home >
Transformator, Trafostation & Co.
Diese Webseite wurde mit Stand Mai 2016 eingestellt, carpe diem! [ weiterlesen ] 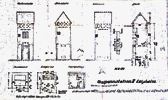
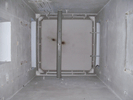

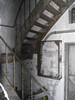

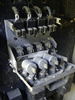
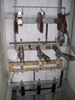

Inhalt dieser Seite: Konstruktion Einblicke Schaltanlage Museums-Turmstation 
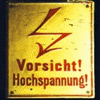


Weitere Seiten: Vorschriften und Erste Hilfe Warntafeln Schalttafeln und Schalter 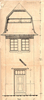
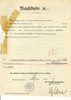
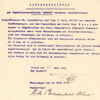
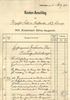

Bauzeichnung und Dokumente der Turmstation Hückeswagen-Herweg von 1913 Abbildungen: Bildarchiv LVR-Freilichtmuseum Lindlar 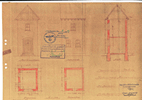
Bauplan der Transformatorenstation Hückeswagen-Kormannshausen von 1943 Abbildung: Stadt Hückeswagen 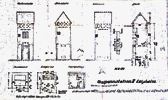

Bauplan der Umspannstation II Leipheim von 1954 Fotos: Hans Zachai, 2013 Die Abbildung zeigt die Konstruktionspläne der Umspannstation II Leipheim der Mittelschwäbischen Überlandzentrale AG Giengen vom 2. März 1954. 
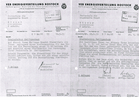

Konstruktionszeichnung der Turmstation Heiligendamm Fotos: Hildegard Rzymann, 2010 Die Abbildungen zeigen die Konstruktionszeichnung eines Trafoturms in Heiligendamm an der Ostsee und zwei Schreiben der VEB Energieverteilung Rostock aus dem Jahr 1953. 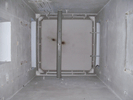
Einblick in einen Trafoturm vor dem Abriss Foto: Fülberth-Maria Köttker, 2010 Ganz auffällig sind die Brandspuren an der Decke. Durch ein Ereignis (Blitzschlag, oder Tropfwasser vom Dach, Schmutz, eingedrungene Vögel...) können Lichtbogenüberschläge in die Decke entstehen, welche ja geerdet ist. Grund für die Brandspuren auf diesem Bild war ein Abreißlichtbogen während eines Schaltvorgangs. Auf dem erkennbaren Stahlträger war seinerzeit ein Trennschalter montiert, welcher mittels Stange vom Boden aus bedient werden konnte. Da nur eine von drei Phasen diese Brandflecken herbeigeführt hat, wäre es denkbar, dass dieser Schalter nicht wie üblich gleichzeitig unterbrochen hat. Möglicherweise hat es dort ein wenig gehakelt oder geruckelt und schon entstand ein Lichtbogen, der seinen Weg in die Decke fand um zu verlöschen. Vor diesem Hintergrund ist es verständlich, dass moderne Anlagen nunmehr lichtbogensicher gebaut werden. Droht damit wenigstens dem Bedienpersonal keine Gefahr mehr. 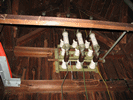





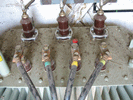
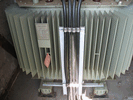

Einblick in die stillgelegte Trafostation Baind Fotos: Richard Molke, 2007 
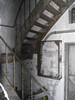
Einblick in eine stillgelegte Trafostation in Radolfzell am Bodensee Fotos: Pit Fischer, 2011 Hier sind so viele Elemente zeitgenössischen Bauens zu finden, dass wir versuchen werden, unsere Fotodokumentation noch auszuweiten. Solche Einblicke findet man nahezu nicht mehr. 
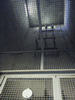

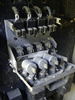

Einblicke in die stillgelegte Trafostation in Vaux-et-Chantegrue, Frankreich Fotos: Richard Molke, 2012 Das Foto ganz rechts zeigt das Plakat mit den Bedienungsvorschriften (Ordre de service). Solche Schilder und Plakate konnten wir bereits mehrfach auf unserer Themenseite Vorschriften und Anleitungen zur Ersten Hilfe dokumentieren. 





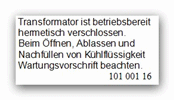
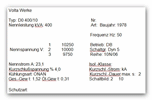
Einblick in eine moderne Trafostation in Dörnach Fotos: Matthias Thalmeier, 2014 

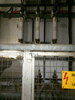



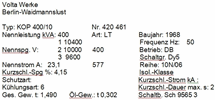
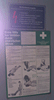
Einblick in eine in Betrieb befindliche Turmstation in Walddorf Fotos: Matthias Thalmeier, 2014 
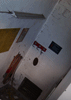



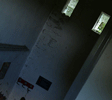
Einblicke in die UST Schule in Pliezhausen-Gniebel (Lkr Reutlingen) vor dem Abriss 2008 Fotos: Matthias Thalmeier, 2007 "Eine Erdungs- und Kurzschließeinrichtung (EuK) ist ein elektrotechnisches Anlagenteil, das nach Feststellen der Spannungsfreiheit dazu dient, ein aktives Anlagenteil allpolig zu erden und kurzzuschließen (Regel 4 der Fünf Sicherheitsregeln). Im Fehlerfall (fälschlicherweises Unterspannungsetzen des freigeschalteten Anlagenteils) wird die Einspeisespannung kurzgeschlossen, es kann keine unzulässig hohe Berührungsspannung entstehen und die vorgeordneten Schutzorgane (Sicherungen, Schutzrelais etc.) trennen das Anlagenteil von der Einspeisequelle." (Quelle: Wikipedia) Das entspricht auch den Teilschritten auf dem dunkelblauen Schild an der Wand. Dort sind die 5 Sicherheitsregeln nochmals notiert. Die Aufnahmen wurden im Jahr vor dem Abriss von außen durch ein Fenster gemacht. 




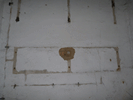
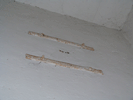

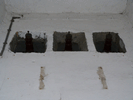


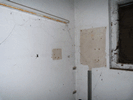


Einblicke in die stillgelegte Turmstation in Hausen an der Aach Fotos: Pit Fischer, 2011 Obere Reihe: Auf der Abbildung links ist die gemauerte Ölauffangwanne zu sehen, auf der früher der ölgefüllte Transformator, das Kernstück der Anlage, stand. Vermutlich hat man hier einfach einmal "rumgemauert" und Bleimenningfarbe zur Dichtung reingestrichen, um im Fehlerfall das auslaufende Öl einzudämmen. Andere Türme hatten dafür Gruben unter dem Trafo. Das zweite Bild von links zeigt eine Art "Nische". Das dürfte die von außen zugemauerte kleine Seitentür für die heute oftmals mit "Straßenbeleuchtung" beschilderte Schalttafel gewesen sein. Nebenan sieht man durch die fehlende Wandfarbe, dass dort die zentrale Niederspannungsverteilung als Schalttafel sowie Sicherungshalter montiert waren. Von dort ging die Niederspannung an der Innenwand wieder hoch zu den 4 Isolatoren Richtung Ortsnetz. Die Fotos in der Mitte zeigen die Leiter, die ins Obergeschoss führt. Ganz rechts (bereits im Obergeschoss) ist die Konterverschraubung der 4 kleinen weißen Isolatoren an der Außenwand zu sehen. Untere Reihe: Die Aufnahmen zeigen weitere Details im Obergeschoss: links die Isolatoren (Wanddurchführungen für die 15 KV Mittelspannung) von innen. Wie man sieht, sind genügend Spinnweben und ihre verhungerten Bewohner vorhanden. Aus diesem Grund war es nötig, gelegentlich mit einem isolierten Besen (hier nicht mehr vorhanden) die Teile der Mittelspannung zu reinigen. Dieser ganze Modder (Staub, Fliegen, Netze usw.) konnte Feuchtigkeit aus der Luft anziehen und damit einen Lichtbogenüberschlag einleiten. Die Funktion der kleinen runden Töpfe auf den drei rechten Abbildungen konnten wir nicht deuten. Evtl. könnten es Halterungen für stationseigenes Bedienwerkzeug gewesen sein (Schaltstange, EuK-Garnitur, Besen), wahrscheinlich jüngeren Datums. 







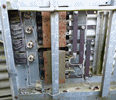
Einblicke in eine abgewrackte Wickmann-Station am Kieswerk Neubrunn Fotos: Pit Fischer, 2012 Neben einer noch in Betrieb befindlichen Trafostation liegt diese bereits abgebaute, die wohl auf die Verschrottung wartet. Das Wrack wurde offensichtlich schon ausgeschlachtet, der Trafo fehlt. Ebenso wurden die HH-Sicherungseinsätze bereits ausgebaut, die Verkabelung liegt am Boden. Einzig die Überspannungsableiter neben den Einführungen am Kopf sind noch dran. Auf dem Trennschalter ist das Typenschild von AEG zu sehen. Daraus lässt sich ableiten, dass diese Trafos in Zusammenarbeit zwischen Wickmann und AEG entstanden. Weiterhin sieht man die Reste der Niederspannungsschalttafel mit Sicherungshalter und Anzeigegeräten für Spannung und Stromstärke sowie einige kleine Steckdosen zum direkten Anschluss von Geräten. Die Wickmann-Blechstationen sind typische Erzeugnisse der (späten) 1960er Jahre. Das beweist auch die Verwendung der Stützer aus Kunstharz im Innern. Meistens befanden bzw. befinden sich Kleintrafos von AEG darin. Der Vorteil der Blechkisten war die flexible Aufstellungsmöglichkeit, bevorzugt für den Einsatz an Baustellen oder wie hier in Kieswerken. War in der Nähe eine Mittelspannungs-Leitungstrasse verfügbar, konnte man mal eben ankoppeln. Die Leistung von 50kVA ist mehr als ausreichend für solche Zwecke und belastet ein vorhandenes Netz nicht sonderlich. Siehe ausführlich auch in unserem Kapitel Wickmann-Stationen. Trafostation Bleiche bei Tuttlingen aus den 1910er Jahren Stillgelegter Trafoturm Glarisegg bei Steckborn (Schweiz) Der Rapunzelturm in Oftringen (Schweiz) Stillgelegte Turmstation Leipheim Riedweg Denkmalgeschützter Trafoturm Grimmelshofen im Hotzenwald 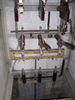




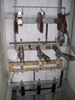
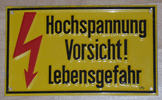
Innenansichten eines Trafoturms vor dem Abbruch Fotos: Richard Molke, 2011 Gut zu erkennen sind die eingeführten Erdkabel im Bild ganz links. Von dort ging es unmittelbar auf bereits abgebaute Messwandler, bevor ein Trennschalter diesen Abzweig zu einer privaten Trafostation von bzw. an die im zweiten Bild von links gezeigte Sammelschiene schaltete. Dies geschah über ein Gestänge, welches durch einen Hebel außerhalb der im Betrieb verschlossenen Zellentür betätigt werden konnte. Das dritte Bild von links zeigt einen weiteren Abgang von der Sammelschiene. Dort ist der gleiche Trennschalter zu sehen, jedoch in geschlossener Form. Bild 4 und 5 von links gehören zusammen. Sie zeigen jeweils ein Ende eines HH-Sicherungshalters. Die Einsätze wurden bereits entfernt. Sie waren in die erkennbaren Klammern eingeklippt. Solche Schaltanlagen waren nötig, wenn mehrere Mittelspannungsleitungen vereinigt und zu- bzw. abgeschaltet werden mussten. Selbst in großen Türmen war dafür kaum Platz und es mussten Nebengebäude errichtet werden. Dennoch zählte diese Schaltanlage zu einer moderneren Bauform. Keine ölhaltigen Schalter, Aluminiumschienen statt Kupfer und Messing, Kunstharz statt Porzellanisolatoren. Im Vergleich zu heutigen SF 6 Anlagen trotzdem museal und unter dem Strich aus technischer Sicht nur noch ein Haufen Metallschrott. (Der Turm selbst ist bereits leer.) Das Foto ganz rechts zeigt das Warnschild, das innen an der Schaltanlage angebracht war. 



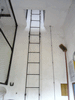

Innenaufnahmen aus der Trafostation Wildes Ried in Kürnbach Fotos: Pit Fischer, 2011 Erstes und zweites Bild von links: Hier ist die Niederspannungsschalttafel mit Verbrauchsmessung zu sehen. Hier waren früher wohl zwei Zähler montiert. Auf der Schalttafel aus Marmor befinden sich unten die beiden Hauptschalter für die beiden abgehenden Stromkreise. In der Mitte findet sich ein Sicherungshalter für die Aufnahme von Sicherungsdrähten. Diese mussten früher noch bei Bedarf lose eingespannt werden, heute gibt es dafür NH Sicherungseinsätze und spezielles Werkzeug bzw. Lasttrenner, die gefahrenfrei für das Bedienpersonal gleichzeitig alle drei Phasen unterbrechen. Neben diesem Sicherungshalter befindet sich ein Drehschalter, welcher die Einschaltung der beiden Drehspulmeßgeräte in die einzelnen Phasen erlaubte. So konnte überprüft werden, ob die angeschlossene Last in etwa gleich auf alle drei Phasen verteilt war und welche Ströme in den einzelnen Zweigen flossen. Es befinden sich noch einige kleinere Schraubsicherungen der Größe K2 auf der Tafel. Sie dienten mutmaßlich als Zählervorsicherungen sowie zur Absicherung der Beleuchtung im Turm. Über der Schalttafel befinden sich drei Bauelemente, deren Funktion nur vermutet werden kann, da ihre Bauform und Platzierung längst überholt ist: Überspannungsableiter (Blitzschutz) für die abgehenden Niederspannungsleitungen. Neben der Schalttafel hängen diverse Tafeln an der Wand. Dabei handelt es sich um VDE-Vorschriften sowie Hinweise zur Ersten Hilfe. Die kleine gelbe Tafel zeigt das Schaltungsschema der Station. In der Ecke steht eine (vermutlich) umgebaute Schalterstange. Regelmäßig mussten die Anlagen von Staub und Spinnweben gereinigt werden. Um an die Anlagenteile zu kommen, brauchte es lange Besen. Damit nicht immer die Station abgeschaltet werden musste, befestigte man solche Bürsten an isolierenden Stangen. Auch heute wird die Wartung von Stationen nach der AUS-Methode angewendet (Arbeiten unter Spannung). Eine weitere Stange fehlt. Damit wurde der Trennschalter im ersten Stock betätigt. Dorthin führt die an der Wand montierte Leiter auf Bild 4 und 5 von links. Bild drei von links: Das Foto zeigt den Kern der ganzen Anlage, den ölgefüllten Transformator. Ihm wird die Hochspannung über die an der Wand geführten Kupferstangen zugeführt. Sie kommen aus dem oberen Stockwerk und führen nach dem Trennschalter mittels Durchführungen in der Decke zum Trafo. Um unbeabsichtigte Berührung oder auch nur Annäherung dieser Leitungen zu verhindern, wurden großflächige Metallgitter angebracht (Bild 6). Auf dem Transformator sitzt ein Tank, der Ölkonservator. Er sorgt dafür, dass sich das Öl im betriebswarmen Zustand ausdehnen kann. Moderne Öltrafos haben im Gegensatz zu diesem Modell einen Kessel mit Kühlrippen zur Wärmeableitung. Unter dem Ölkonservator gehen die Niederspannungsleitungen sowie der Neutralleiter ab. Sie führen zu einem freistehenden Sicherungshalter (heute undenkbar) nach gleichem Muster wie auf der Schalttafel. Danach verschwinden sie im Boden um hinter der Schalttafel wieder zu erscheinen.

| |||||||||

