www.trafoturm.eu |
|||||||||
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|||||
| Wir begreifen Ruinen nicht eher, als bis wir selbst Ruinen sind. (Georg Christoph Lichtenberg) | |||||||||
|
Home >
Europa >
Deutschland >
Mecklenburg-Vorpommern >
Mecklenburgische Seenplatte
Diese Webseite wurde mit Stand Mai 2016 stillgelegt [ weiterlesen ] Zur Gemeinde Breesen gehören auch die Ortsteile Kalübbe und Pinnow: 




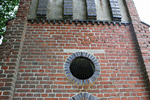




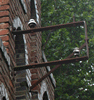

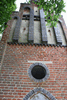

Das Transformatorenhaus beim Gutshaus Pinnow, um 1920 Fotos: Manfred Kühl, 20. Juni 2014 Die Detailabbildungen in der unteren Bildreihe zeigen Reste der alten elektrischen Armaturen: Auf den drei Bildern links ist der ehemalige Niederspannungsabgang zu sehen: hier sitzen auf einer Konsole noch zwei restliche Rillentellerisolatoren. Auf den drei rechten Fotos sind die ehemaligen Mittelspannungs-Wanddurchführungen zu sehen. Es dürfte sich hier vermutlich um ein Netz mit 10 bis 15 KV gehandelt haben. 20-KV-Durchführungen im Freiluft-Innenraum-Gebrauch hatten zumindest zwei Außenschirme, später sogar drei und mehr. Früheste Überland-Netze im Regelbetrieb waren für 5 bis 8 KV ausgelegt. Das nicht weit entfernte Altentreptow erhielt im Jahr 1916 Anschluss an das Stromnetz. Dies dürfte auch für Pinnow zutreffen. Aufgrund dieser Tatsache und der vorgefundenen Situation der Mittel- und Niederspannungsanbindung gehen wir davon aus, dass diese Turmstation aller Wahrscheinlichkeit nach in den späten 1910er bzw. frühen 1920er Jahren in Betrieb genommen wurde, also in der normalen Zeit der Ausbreitung von Mittelspannungsnetzen zwischen 10 und 20 KV in Deutschland. 
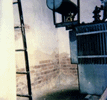
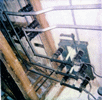
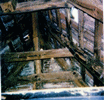
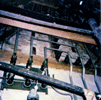
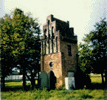
Fotos um 1993, mit freundlicher Genehmigung der E.DIS AG Altentreptow 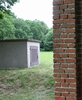 Laut Auskunft des regionalen Energieversorgers, der E.DIS AG Altentreptow, sind keinerlei Unterlagen bezüglich
der Inbetriebsetzung des alten Trafogebäudes auffindbar.
Mit der Inbetriebnahme einer neuen Trafostation am 13. Januar 1993 ist die alte außer Dienst gestellt worden.
Das nebenstehende Foto zeigt den Nachfolger des alten Trafohauses: eine moderne
Kompaktstation für Erdkabel.
Laut Auskunft des regionalen Energieversorgers, der E.DIS AG Altentreptow, sind keinerlei Unterlagen bezüglich
der Inbetriebsetzung des alten Trafogebäudes auffindbar.
Mit der Inbetriebnahme einer neuen Trafostation am 13. Januar 1993 ist die alte außer Dienst gestellt worden.
Das nebenstehende Foto zeigt den Nachfolger des alten Trafohauses: eine moderne
Kompaktstation für Erdkabel.
Das rechte Foto in der obigen Bildreihe mit der Hausansicht aus den 1990er Jahren, der Zeit der Umstellung auf die neue Kabelstation, zeigt das ehemals vorhandene Stahlträgerportal mit mindestens zwei, eher sogar drei Deltaisolatoren für jedes ankommende Leiterseil. Man sieht auf Bildern aus dem Jahr 2014 (siehe oben auf dieser Seite) nur die Reste der Träger an der Schnittstelle zum Mauerwerk. Die auf den Innenaufnahmen zu sehenden Armaturen sind nach Bauart wohl Standartbauteile der 1950er bis 1960er Jahre, sehr wahrscheinlich aus dem Elektrokeramikwerk Sonneberg. Auf dem Foto ganz links sieht man einen Kabelendverschluss für ein älteres Masse/-Ölkabel. Ob es sich hierbei um eine neue Einspeisung in die Trafostation nach Demontage der Freileitungszugänge der Mittelspannung gehandelt hat oder ob es der Abgang eines Erdkabels zum zweiten Trafoturm war, bleibt unbeantwortet. Mit der neuen Kompaktstation hat es wohl aber schon altersbedingt nichts mehr zu tun. Solche Einblicke in alte Turmstationen sind selten. Einige konnten wir bereits auf unserer Sonderseite Innenansichten und Konstruktion von Turmstationen dokumentieren. 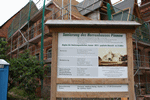
 Pinnow liegt zwischen Neubrandenburg,
Altentreptow und
Wolde.
Pinnow liegt zwischen Neubrandenburg,
Altentreptow und
Wolde.
Das Gutshaus wurde 1863 durch Conrad Wilhelm Hase (Planung und Baubegleitung) unter dem Bauherrn Friedrich von Klinggräff begonnen, von 1865 bis zur Fertigstellung 1869 erfolgte die Betreuung des Vorhabens durch Heinrich Wiethase, Diözesanbaumeister zu Köln. Nach 1945 diente der Gutshof als Wohn- und Gemeindehaus, Post und Sitz der LPG-Verwaltung und stand seit ca. 1980 leer. 2013 wurde mit der Sanierung der Gebäude begonnen, geplante Bauzeit: ca. 8 Jahre (siehe nebenstehende Abbildungen). Ob sich die Angaben zur Baugeschichte auch auf Nebengebäude wie dieses Transformatorenhaus beziehen, wissen wir nicht. Wenn die Familie von Klinggräff unter Leitung des Kölner Diözesanbaumeisters 1869 auch dieses kleine Backsteinhaus hat bauen lassen, dann auf jeden Fall nicht als Trafostation. In diesem Fall müsste es ca. 50 Jahre später zum Transformatorenhaus umfunktioniert worden sein. Unserer Einschätzung nach ist es wahrscheinlicher, dass die Turmstation - neugotisch stilgerecht passend zum Herrenhaus - erst nach 1916 gebaut, auf jeden Fall aber in Betrieb genommen wurde. Laut Liste der Baudenkmale in Breesen steht die gesamte Gutsanlage als Baudenkmal unter Schutz, mit Gutshaus, Park, Scheune, zwei Transformatorenhäusern, Kirche mit Friedhof und Kriegerdenkmal. Hier werden ausdrücklich zwei Trafohäuser genannt. Die zweite Turmstation stellen wir im folgenden vor: 






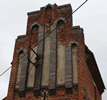

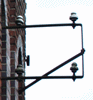
Zweites Transformatorenhaus beim Gutshaus Pinnow Fotos: Manfred Kühl, 20. Juni 2014 (Quelle: Zuschrift eines Familienmitglieds der heutigen Besitzer vom 22.11.2017) Anfangs hatten wir Zweifel, ob es sich hier wirklich um eine Transformatorenstation handelt. Uns stellte sich zunächst die grundlegende Frage, warum in einer Zeit, als längst nicht so viel Strom verbraucht wurde wie heute, zwei derartig große Trafostationen so dicht beieinander hätten gebaut werden sollen. Es sind keinerlei Anzeichen für Mittelspannungseinrichtungen im Freileitungsbetrieb zu finden, also von einer hochvoltigen Stromzufuhr, die dann vom Trafo im Innern in gebrauchsfertigen Strom (Niederspannung) umgesetzt worden wäre. Andererseits könnte der Trafo auch vom ersten Trafohaus aus über ein Kabel versorgt worden sein, da es zu dieser Zeit Hochspannungskabel schon gab (für die Anwendung hauptsächlich innerhalb von dichter Stadtbebauung). Auf der Niederspannungsseite haben wir folgende Situation vorgefunden: Oben an der Fassade sind als Reste der früheren Niederspannungsarmaturen zwei Konsolen zu sehen, davon eine noch mit vier Rillentellerisolatoren besetzt (siehe Detailfotos unten rechts). Bei einer Trafostation dienen solche Niederspannungsabgänge zur Stromverteilung an die Endverbraucher (z.B. Wohnhäuser, Gewerbebetriebe, Dreschmaschinen). Andererseits könnte eine der Konsolen auch zur Stromzufuhr in das Gebäude gedient haben, vergleichbar einem Dachanschluss an einem Wohnhaus, die zweite zur Weiterleitung an einen weiteren Verbraucher. Auf dem Bild unten links ist eine zugemauerte Mauernische zu sehen. Hier könnte sich ursprünglich die Schalttafel zur Niederspannungsverteilung befunden haben. Im Gegensatz zur Trafostation Nr. 1 sind hier jedoch keinerlei Reste der Türangeln zu finden. "Ab 1905 begannen private und öffentliche Überlandwerke verstärkt, den ländlichen Bereich mit Strom zu erschließen. Nach und nach konnten Landbetriebe, Handwerker und ländliche Einwohner mit Drehstrom über Freileitungen mit in der Ferne erzeugtem Strom versorgt werden. Dabei entstanden meist eindrucksvolle Turmstationen." (Primus, Geschichte und Gesichter der Trafostationen, 2013, S. 32). Im Inneren dieses Trafohauses sind noch elektrische Armaturen aus der DDR-Zeit vorhanden, die wir nachfolgend vorstellen: 

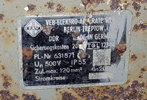
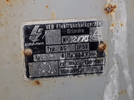
Innenaufnahmen: Armaturen aus der DDR-Zeit Fotos: Fabian Müller, 3. Februar 2018 Ebenso sehen wir hier eine gekapselte Niederspannungsverteilung, wie man sie eigentlich in Industriebetrieben verwendet hatte. Da hier die zugehörigen Familiennamen aufnotiert sind, kann man davon ausgehen, dass dort die zugehörigen Hausanschlussicherungen (NH-Einsätze bzw. ältere Schraubkappen K3) verbaut waren. Statt in der jeweiligen Wohnung hatte man diese offensichtlich ausgelagert. Nachdem das Herrenhaus in der DDR in verschiedene Wohnungen unterteilt war, diente die Station offensichtlich auch als Verteiler für die einzelnen Wohnungen. In der Gesamtschau mit dem anderen Trafoturm (siehe oben) ergibt sich dann eine Aufteilung, wie sie auch heute noch bei begehbaren Netzstationen anzutreffen ist. Eine Tür öffnet sich zum eigentlichen Traforaum, eine weitere gewährt Zugang zur Niederspannungsverteilung. Die Gebäudehälfte der Niederspannung konnte ohne weitere Gefährdung für Personen betreten werden. Dem Trafo selbst sowie den zugehörigen Trennern und HH-Sicherungen sowie blanken Stromschienen durfte man sich nur auf Sicherheitsabstand bzw. mit geeigneten Schaltstangen oder Zangen zum Sicherungswechsel nähern. Es gab zumeist einen roten Holzbalken, welcher bei eingeschalteter Station als Zugangsgrenze nicht übergriffen oder überschritten werden durfte. Somit wurde eine potenziell gefährliche Annäherung an Bauteile, welche unter Mittelspannung standen, verhindert.

| |||||||||

